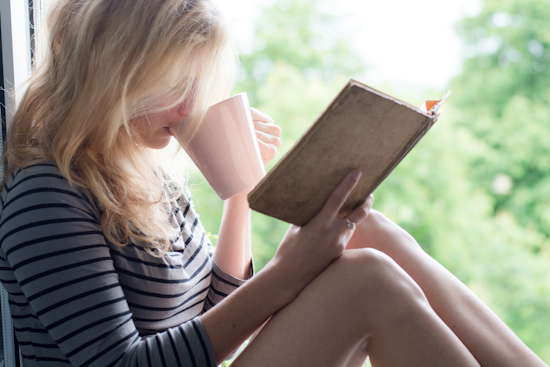Lernen ohne verplant zu seinZeitmanagement fürs Studium

Die Einteilung der Zeit ist das Gerüst des Lernens. Ehe du dir die Zeit einteilst, musst du aber erst einmal herausfinden, wie viel Zeit dir zur Verfügung steht. Wichtig ist hierbei, nicht nur die Verpflichtungen (Uni, Job, Haushalt etc.) aufzulisten, sondern auch Pausenzeiten einplanen, Freizeit, Fahrtwege, Einkaufen etc… Ziel der Zeitplanung ist es, Struktur in den Arbeitsalltag zu bringen, d.h. Einteilung in Wichtiges und Unwichtiges sowie in Bereiche (Lernen, Freizeit, Haushalt…) vorzunehmen. Notwendig ist hierfür die Änderung der bisherigen Lebensgewohnheiten. Eine bewusste Lebensplanung soll die alte Routine ersetzen. Das Zeitmanagement erfordert, je nach individueller Problemstellung, unterschiedliche Pläne. So kannst du das Semester planen, das Jahr, das Studium, aber auch im Kleinen, den Monat, die Woche den Tag. Am effektivsten ist die Kombination aus Langzeitplanung, Kurzzeitplanung und Tagesplanung. Ohne klare Übersicht über anstehende Aufgaben kannst du keine Prioritäten setzen – also erst informieren, dann planen! Wichtig ist hierbei, sowohl Puffer als auch Pause nicht zu übersehen und auch für die Freizeit und Erholung Raum zu lassen. Da die Zeitplanung schriftlich erfolgen soll, erleichtern Hilfsmittel wie z B. Tagebuch-Kalender, Wochen – Monats – und Jahresplaner die Arbeit. Auch Unterstützung von FreundInnen, der Lerngruppe, der Familie ist insbesondere in der Anfangsphase hilfreich. Der Plan sollte so genau wie möglich sein. Ein Tages – oder Wochenplan also Stundenangaben enthalten, ein Jahresplan mindestens Monate, ein Monatsplan die Wochen. Im Groben sollte geplant werden was ansteht, in feineren Details die konkrete Zeitplanung vorgenommen werden. Hierbei gilt: regelmäßig Planung und Realität abgleichen und den Plan ggf. anpassen! Vor allem am Anfang neigt man dazu, sich zu überschätzen. Und nicht zuletzt bringt der beste Plan nichts, wenn er nicht auf die individuellen Bedürfnisse und den Biorhythmus des / der Einzelnen abgestimmt ist. Es muss also eine für dich persönlich sinnvolle Struktur entstehen mit eigenen Ritualen, feste Zeiten und Abläufen sowie Ordnung und Übersicht. Artikeltipp: Wie du im Home Office gut lernst – und dabei nicht durchdrehst! Wer vom Home Office aus studiert, hat mit speziellen Hürden zu kämpfen, die bei einem „normalen“ Studium vor Ort nicht vorkommen. Warum? Weil schnell die Struktur abhanden kommen kann. Hier erfahrt ihr Tipps zum Digitalen Lernen. weiter Anstehende Aufgaben unterteilst du nach ihrer Priorität, da nicht jede Aufgabe gleich wichtig ist. Dies kann z.B. in Form von Unterteilung in A, B und C – Aufgaben erfolgen. »Unsere Zeit wird uns teils geraubt, teils abgeluchst, und was übrigbleibt, verliert sich unbemerkt.« A. – sofort erledigen – sehr wichtig Unwichtige Dinge von den Wichtigen zu Unterscheiden kannst du durch die Beurteilung der Dringlichkeit. Dringlich sind zumeist die Aufgaben, welche von anderen kommen. Den Computer für eineN FreundIn reparieren, den Knopf für jemanden annähen, den Hund von NachbarInnen Gassi führen… Als Faustregel gilt: Wichtigkeit geht vor Dringlichkeit! Somit sind A-Aufgaben und Notfälle wichtig. Um mit der Prioritätenliste arbeiten zu können ist es wichtig, langfristige A-Aufgaben nicht aus den Augen zu verlieren. So ist es z.B. sinnvoll jeden Tag an einer langfristigen, wichtigen Aufgabe zu arbeiten um zu verhindern, dass nur Tagesaufgaben abgearbeitet werden. 1. Voraussetzungen: Lernplan erstellen – so startest du

2. Prioritäten setzen mit der A-B-C-Methode

(Seneca)
B. – terminieren oder delegieren
C. – delegieren und reduzieren
3. Zeitdiebe erkennen & vermeiden – die größten Stolpersteine
Die Probleme können jedoch auch aus dir Selbst kommen, z. B. wenn dir die Fähigkeit ‚nein‘ zu sagen fehlt, du wichtige Dinge aufschiebst oder die Arbeit unkonzentriert verläuft. Sich dieser zeitschluckenden Ablenkungsmanöver bewusst machen, ist schon der erste Schritt für eine bessere Zeitplanung.
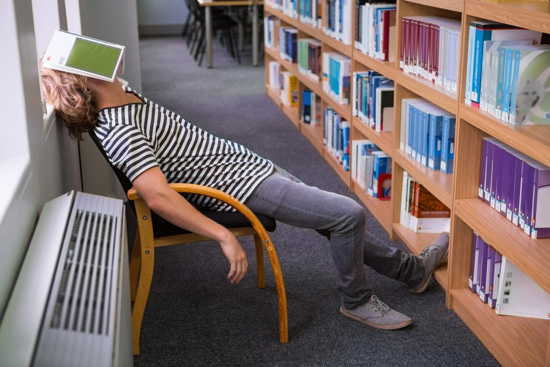
Wenn am Ende des Semesters die Batterie alle ist – ist es schon fast zu spät. Am besten das Semester frühzeitig planen und Zeitdiebe bedenken.
Insbesondere für die „Zeitfresser“ Post, Mails, Telefon bietet es sich an, feste Zeiten am Tag einzurichten und diese Zeit auch zu limitieren. Wenn du dich also gern damit ablenkst, Mails zu lesen, hilft es dir sicherlich, fortan eine feste Zeit für das Lesen und Bearbeiten einzuplanen und diese, entsprechend den individuellen Anforderungen und Aufgaben, zeitlich zu begrenzen. Zum Beispiel: Ich lese und beantworte Emails nur vor dem Lernen von 09:00 bis 09:30.
Auch können die Zeitdiebe in mangelnder Planung oder Methodik bestehen: keine klaren Ziele, fehlende Übersicht, keine Tagesplanung. Vielleicht hast du dir auch einen ungünstigen Arbeitsstil antrainiert, wenn du dich in ein Prüfungsthema zu genau reinhängst und für die 20 anderen Themen keine Zeit mehr bleibt. Weitere Marotte kann auch die Unordnung sein – wenn du deine Notizen des Semesters an unzähligen Orten verstreut hast, muss diese Zeit am Schluss doppelt und unnötig einplanen.
Störungen von außen, wie Anrufe, spontane Besuche oder ein lauter Arbeitsplatz fressen Zeit und stören die Konzentration. An äußeren Faktoren kannst du nichts ändern? Da hast du du getäuscht. Schonmal den Flugmodus am Smartphone ausprobiert? Oder zum Lernen die trubelige Cafeteria mit der kleinen unbekannten Institutsbibliothek am Stadtrand getestet?
Die Probleme können jedoch auch aus dir Selbst kommen, z. B. wenn dir die Fähigkeit „nein“ zu sagen fehlt, du wichtige Dinge aufschiebst oder die Arbeit unkonzentriert verläuft. Hast du die Probleme erst einmal erkannt, so kannst du sie auch effektiv angehen (siehe übrige Abschnitte).
Insbesondere ist noch anzumerken, dass es hilft, mit der Aufgabe zu beginnen, die am unbeliebtesten ist. Die Folgenden fallen wesentlich leichter.
Wenn du häufig von deinen WG-GenossInnen oder FreundInnen unterbrochen wirst: ein Schild „Bitte nicht stören“ tut Abhilfe. Oder die Klingel abstellen und das Handy in den Flugmodus versetzen. Zudem haben FreundInnen Verständnis dafür, wenn du erklärst, dass nun Lernzeit angesetzt ist, du dich dafür aber in der Freizeit um ihre Belange umso intensiver widmen kannst.
4. Langzeitplanung Studium: Semester & Prüfungen strukturieren
Mit der Langzeitplanung lässt sich z.B. ein Semester und die darin liegenden Prüfungen vorbereiten. Aber auch das Studium, ein bestimmter Abschnitt des Studiums etc. kann geplant werden. Wenn du mit dem ganzen Studium beginnen möchtest, kannst du z.B. eine Langzeitplanung aufstellen, die festhält, was du pro Semester erreichen möchtest. Und dann, zu Beginn eines jeden Semesters wiederum dieses Semester planen. Und innerhalb des Semesters dann die Wochenplanung in Angriff nehmen.
Die Planung des Studiums dient einem groben Überblick. Hier sind zu erbringende Leistungen für deine Module ebenso zu erfassen, wie auch Praktika und Auslandsaufenthalte. Die notwendigen Informationen ergeben sich aus den Prüfungsordnungen, Studienordnungen, Studienführern und können auch bei der Studienfachberatung eingeholt werden.
Für die Semesterplanung bietet es sich an, eine Tabelle zu erstellen, welche Aufgaben für wann anstehen. Für jede Woche werden für jedes Gebiet die Ziele aufgestellt. Sind z. B. Skripte zu lesen, so kann pro Woche eine bestimmte Seitenzahl festgehalten werden. Wichtig ist hierbei, dass du dich nicht übernehmen solltest. Günstig ist es, wenn du vor Prüfungen in deiner Langzeitplanung Zeit für Wiederholung einplanst.
Und dann kam auf einmal ganz urplötzlich dein Festival, wo du jedes Jahr hinfährst? Und du hast plötzlich für nichts mehr Zeit? Selbstverständlich darfst du dich auch weiterhin deinen privaten Vergnügen und regelmäßigen Freizeitaktivitäten widmen. Du solltest sie nur frühzeitig einplanen, damit du nicht am Ende in totalen Stress gerätst.
5. Wochenplan für Studenten: So bleibst du auf Kurs
Sinnvoll ist es, neben einer Langzeitplanung sowohl eine Wochen- als auch eine Tagesplanung vorzunehmen.
Generell gilt: eine zeitliche Tagesstruktur unter Berücksichtigung persönlicher Kapazitäten und Bedürfnissen sollte sich wie ein Roter Faden durch den Alltag und die Woche ziehen.
Die Planung für eine Woche kann z. B. auf einem Stundenplan erfolgen. Pro Semester kannst du dir diesen für jede Woche einmal kopieren und die wochenspezifischen Termine eintragen.
Für die Eintragungen im Wochenplan bieten sich unterschiedliche Farben an. Zunächst sollten die Aufsteh – und Zu-Bett-Geh-Zeiten markiert werden (für die Routinierten). Feststehende Hochschul-Termine (Vorlesungen etc.) sind ebenfalls zwingend aufzunehmen. In der verbleibenden Zeit sind selbstständige Arbeitsstunden einzutragen. Bei der Planung sollten Wegzeiten, Haushaltsarbeit, Freizeit, Job und Pufferzeiten berücksichtigt und ggf. eingetragen werden (zur Zeiteinteilung siehe auch Arbeits- und Pausenzeiten).
Wenn du die Woche über konsequent arbeitest, solltest du dir einen komplett Uni-freien Tag gönnen. Dieser dient der Erholung. So kann in der verbleibenden Zeit umso effektiver gearbeitet werden.
6. Tagesplanung – der Schlüssel zur Produktivität
Für die Tagesplanung bietet sich ein Tagebuch-Kalender an. Aber auch ein Schreibblock kann gute Dienste leisten. Wichtig ist letztlich die Schriftlichkeit. Schriftliche Pläne machen Aufgaben greifbar und helfen, Fortschritte zu tracken.
Der Tag sollte immer am Vorabend geplant werden. Hilfreich sind hier folgende Fragen
„Was ist wichtig, was zeichnet den Tag aus?“ (z.B. Seminartermin, Mutters Geburtstag, Fachschaftsparty…). – das wirklich wesentliche wird festgehalten.
„Was MUSS erledigt werden?“ Hilfreich ist es eine Prioritätenliste zu erstellen und dir z.B. die drei wichtigsten Aufgaben des Tages klar zu machen. Häufig stellt sich heraus, dass vermeidlich dringendes gar nicht erledigt werden muss.
„Was ist wichtig in der nächsten Zeit?“ Hier spielen z.B. Abgabetermine, der Urlaub, anstehende Klausuren eine Rolle. So wird die Aufmerksamkeit auf wichtige Dinge in der nahen Zukunft gelenkt.
Steht fest, was für Aufgaben du bewältigen musst, so erfolgt nun die Bewertung dieser Aufgaben: „Wie wichtig ist die Aufgabe? Wie viel Zeit wird was in Anspruch nehmen? Was ist dein persönliches Zeitlimit für welche Aufgabe?“
Stehen die Aufgaben fest, teilst du den Tag ein. Hierbei solltest du beachten, dass Pufferzonen erhalten bleiben. Sie dienen dem Auffangen von unvorhergesehenen Ereignissen. Diese können z.B. sein: Störungen, Ablenkungen, spontane Gelegenheiten und Bedürfnisse, Treffen von FreundInnen… Daher sollte, als Richtwert, ca. 60% der Zeit, also zwei Drittel, fest verplant werden. Die verbleibenden 40% teilen sich auf in Zeit für unerwartete Ereignisse und spontane Aktionen.
Ebenfalls zur Zeitplanung gehört ein positiver Tagesbeginn und Abschluss. So hilft es, dir jeden Abend ein Erlebnis, eine Sache die gut war, aufzuschreiben. Ebenso solltest du für den nächsten Tag eine Sache finden, auf die du dich freust.

Für Zwischenpausen lohnt es sich, einen kurzen Spaziergang einzulegen – optional auch mit deinem Lieblings-Heißgetränk!
Arbeits- und Pausenzeiten
Wichtig sind Pausenzeiten. Diese solltest du nicht als Belohnung betrachten, sondern gehören zur Arbeitszeit und sind notwendig für eine ausdauernde, konzentrierte Arbeit. Es gibt hierbei verschiedene Formen der Pausen:
Abspeicherpausen (10-20 Sek.): Der Lerninhalt wird „abgespeichert“. Ein kurzes Innehalten im Arbeitsprozess erfolgt.
Kurzpausen (3-5 Min.): Entstehen beim Wechsel zwischen Lerninhalten, Lernmethoden um auf das Neue einzustimmen. Sie können auch hilfreich sein, um einen Zusammenhang zu begreifen wenn Verständnisprobleme auftreten.
Zwischenpausen (15-20 Min.): Sie sind nach einer intensiven Lerneinheit (max. 90 Min.) Pflicht, da natürliche Ermüdungserscheinungen auftreten. Der Arbeitsplatz sollte verlassen und eine entspannende Tätigkeit ausgeübt werden (Spazieren gehen, Lesen…)
Erholungspause (1-2 Std.): Nach max. 4 Stunden Lernen sollte eine Erholungspause erfolgen. Dies kann z. B. in Gestalt einer Mittagspause mit Mittagessen erfolgen. Für die Einteilung der Pausen – und Arbeitszeiten ist es notwendig, deine individuelle Tagesform festzustellen. In der Zeit, in welcher die Aufnahmefähigkeit am höchsten ist, sollten die anstrengenden Aufgaben, wie z.B. Auswendig lernen, liegen.
Bei der Festlegung der Arbeitszeiten und des Pensums ist zu beachten, dass auch das Lernen eine Trainingsfrage ist. So wird eine Stunde Lernen zu Beginn wesentlich schwerer fallen und anstrengender sein, als nach einigen Wochen konsequenten Lerntrainings.
7. Zeitplanung zur Prüfungsvorbereitung
Die Vorbereitung auf Prüfungen sollte in vier Schritten erfolgen:
Vorbereitung
Aneigung des Stoffes
Vertiefung des Stoffes
Überprüfung des Gelernten
Vorbereitung erfasst das Besorgen aller benötigten Materialien (Literatur, Bücher, Skripte, Prüfungsfragen etc.) und der erforderlichen Informationen (Prüfungsordnung, Termine, etc.). Ebenfalls ist es sinnvoll den Kontakt zum / zur PrüferIn herzustellen (Sprechstunde), um auftretende Fragen klären zu können. Sämtliche Materialien zur Prüfungsvorbereitung sollten am Ende der Vorbereitungsphase vorhanden sein.
Nun folgt die Hauptphase: Das Erarbeiten des Stoffes. Die Inhalte und Fächer werden einmal gründlich durchgearbeitet. Diese Zeit will gut geplant sein. Wie viele Tage oder Wochen sind für die einzelnen Fächer erforderlich? Pufferzeit und Puffertage zum Auffangen unvorhergesehener Ereignisse sind hierbei ebenfalls zu planen. Kurzwiederholungen, z. B. immer am Ende einer Woche, helfen das Gelernte besser im Gedächtnis zu behalten.
In der Vertiefungsphase, sie sollte deutlich kürzer sein, wird das Gelernte wiederholt und vertieft. Zunächst kann es frustrierend sein, da die Wissenslücken deutlich zu Tage treten. Dies ist normal. Das Gelernte muss wieder reaktiviert werden, da nach jedem Lernprozess ein Teil vergessen wird. Ruhe und Zuversicht bewahren sowie weiterarbeiten überbrücken diese Phase.
Die Überprüfungszeit umfasst wenige Tage vor der Prüfung. Die einzelnen Inhalte werden nochmals wiederholt und ggf. vertieft.
„Jokertage“ helfen die Zeit gut zu überstehen. Sie sind terminlich als Lerntage zu planen, jedoch nicht mit Inhalt zu belegen. Benötigst du sie nicht, um unvorhergesehene Verzögerungen und Ereignisse auszugleichen, so sollten sie, sozusagen als Belohnung, für die Freizeit verwendet werden.
Hilfreich für die Zeitplanung ist es rückwärts zu planen. Dies bedeutet vom Termin der Prüfung ausgehend, zunächst die Überprüfungszeit, dann die Vertiefungszeit, die Hauptzeit und zuletzt die Vorbereitungsphase zu planen. Ein freier Tag vor der Prüfung sollte ebenfalls eingeplant werden. Nach der Überprüfungsphase ist eine Sicherheitsreserve von einigen Tagen sinnvoll, sofern dies möglich ist.
🤕 Bevor alles reißt
Alle Probleme werden sich vielleicht nicht immer mit einem besseren Zeitmanagement lösen lassen. Das geben leider die wenigsten Ratgeberartikel und Bücher zu. Somit erscheint ein Versagen als ein rein individuelles Problem – aber manchmal sind die Studienbedingungen einfach schwierig im Alltag lösbar, wenn das Curricula viel zu voll gestopft wurde. Eine plötzliche Erkrankung lässt sich natürlich auch nur bedingt einplanen.

Artikeltipp: Durch klarere Prioritäten entspannt und erfolgreich studieren
Zu viele Lehrveranstaltungen belegt, zu viele Projekte angenommen – und dann noch der Studentenjob und die vielen spannenden Asta-Kurse…! – Wer zu viel auf dem Zettel hat, verzettelt sich schnell mal. Das Gegengift: Klare Prioritäten im Studium und vier magische Buchstaben: NEIN. weiter
Wenn alles nicht mehr geht und du nicht alle Ziele für das Semester erreichst, musst du die Reißleine ziehen und schlicht umplanen. Vielleicht hilft dir auch eine Beratungsstelle, um ein Problem zu lösen.
Kurz + knapp
Lege dir sobald du den Prüfungstermin weißt, einen Zeitplan zurecht. Beachte, dass du genügend freie Lücken für Freizeit, Haushalt oder Lernpausen in diesen Zeitplan einbaust. Genauere Angaben und viele weitere Tipps geben wir dir hier
Keine Panik. Prüfe, ob du dich während des Lernens von vielen Dingen ablenken lässt, falls ja, beseitige diese Ablenkungen (Handy aus, FreundInnen informieren, dass du erst lernst). Wenn du Schwierigkeiten hast pünktlich anzufangen, setze dir ein Zeitlimit bis wann du angefangen haben musst.
Du kannst dir beispielsweise einen Stundenplan häufig kopieren und für jede Woche kopieren. So kannst du bis auf die Minute genaue Termine anlegen und einen Überblick behalten. Nutze zusätzlich verschiedene Farben um zwischen Arbeits- und Freizeitterminen zu unterscheiden.
Buchtipps (Werbung)
Buchtipps sind redaktionell ausgewählt. Wir erhalten eine kleine Provision, wenn über den Link auf Amazon eingekauft wird.
Übersicht „Lernmethoden und Zeitmangement“
- Die Gestaltung des Arbeits- und Lernplatzes
Zeitmanagement (hier bist Du)
- Selbst-Motivation
- Konzentration und Grundlagen des Lernens
- Aufmerksamkeit und Tunnelblick = Höchste Konzentration
- Lerntechniken
- Die Prüfung – gut vorbereitet und organisiert

Artikeltipp: Schnelles fokussiertes vs. breites fundiertes Studium
Was ist besser: Sein Studium schnell und fokussiert „durchziehen“? Oder kann es nicht auch sinnvoll sein, beim Studieren links und rechts die Augen offen zu halten und sich breit aufzustellen? Es kommt darauf an, was das Ziel ist und wie die Voraussetzungen sind. weiter
Hinweise der Redaktion:
Das oben angegeben Datum zeigt den letzten Stand der Aktualisierung nicht der Erstveröffentlichung an.