Blackout bei PrüfungenWie Studierende der plötzlichen Leere entgegenwirken können
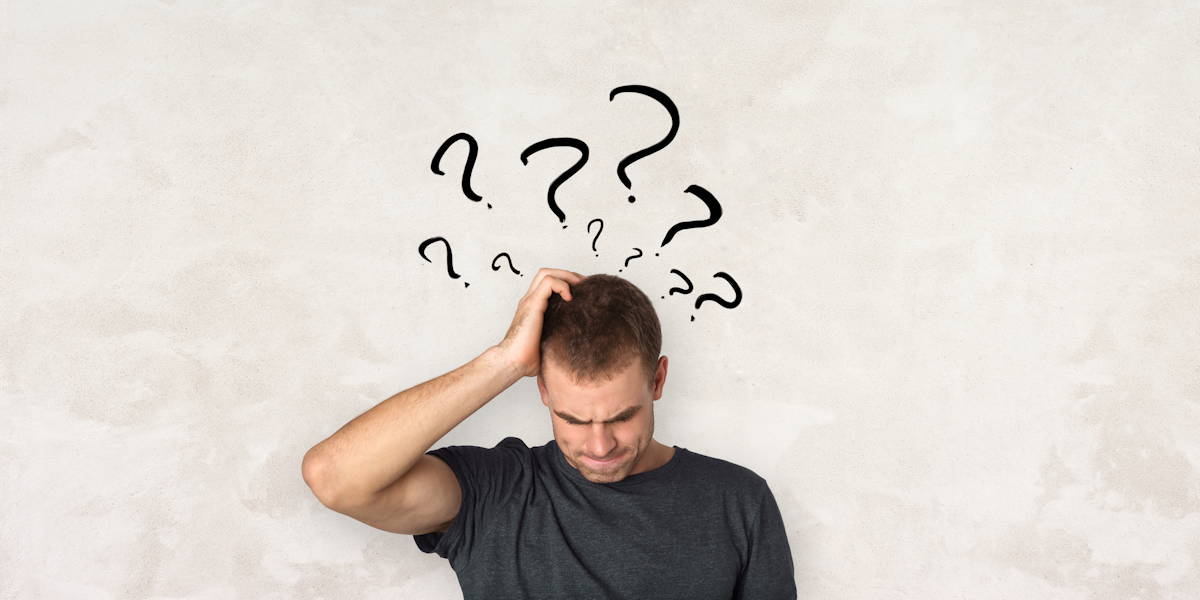
Von Sabine Grotehusmann
1. Kurz + knapp
Blackout ist ein Sammelbegriff für einige Bedeutungen. Unter einem Blackout bei Prüfungsangst versteht man: einen plötzlich auftretenden, kurz dauernden Verlust des Bewusstseins und/oder Erinnerungsvermögens. Salopp ausgedrückt, du sitzt in der Prüfung und all deine Vorbereitung ist auf einen Schlag weg.
Die Devise heißt: Dampf ablassen! Lebe die Flucht- oder Kampfreaktion in einem kleinen Rahmen aus. Verlasse den Prüfungsraum, wenn möglich, und bewege dich etwas, schüttle deine Hände und Füße aus. Du kannst auch auf einem Schmierzettel fluchen, wichtig ist nur, dass du die Energie irgendwie heraus lässt.
Gute Vorbereitung und eine Strategie sind immer gut, um in einer Prüfung nicht in Angst zu verfallen. Du kannst aber auch andere Techniken verwenden. Arbeite beim Lernen mit Akronymen und Eselsbrücken, schreibe schwere Formeln sofort auf einen Schmierzettel, bevor du mit der Bearbeitung anfängst, oder bereite dich mental auf deinen Blackout vor! Das letzte Beispiel findest du auch bei Leistungssportlern:innen.
Die Angst vor einem Blackout ist wie die Angst vor einem Schlangenbiss. Beide sind weit verbreitet. Doch die Angst ist unbegründet. Schlangenbisse sind viel seltener als befürchtet. Außerdem hat die Weltgesundheitsorganisation herausgefunden, dass die meisten Menschen, die an einem Schlangenbiss sterben, nicht etwa am Gift, sondern an ihrer eigenen Angst sterben. Sie geraten in Panik, drehen durch und ihr Kreislauf kollabiert. Wer gebissen wird, darf nur nicht in Panik geraten. Es gilt, Ruhe zu bewahren!
Genauso verhält es sich mit der Angst vor einem Blackout. Auch Blackouts treten viel seltener auf als befürchtet. Überlege einmal wie viele Tests, Klassenarbeiten, Klausuren, Prüfungen, Aufführungen und Wettkämpfe du in deinem Leben schon miterlebt hast und wie oft du oder einer der Teilnehmer dabei einen Blackout hattet.
Und wer den seltenen Fall eines Blackouts erlebt, der sollte an den Schlangenbiss denken und ruhig bleiben, statt sich zur Panik hinreißen zu lassen. Das Gelernte ist nicht plötzlich weg. Es steht nur vorübergehend nicht zur Verfügung. Damit es gar nicht erst dazu kommt, kannst du im Vorfeld aktiv werden.
2. Sechs Tipps, dem Blackout zuvorzukommen
Jeder weiß, wie einem Blackout vorzubeugen ist. Durch eine gute Vorbereitung. Effiziente Lerntechniken und ein realistischer Zeitplan sind eine Selbstverständlichkeit. Doch es gibt noch weitere, gezielte Hilfen. Für die schriftliche Prüfung hat sich ein Trick als besonders guter Schutz vor Blackouts erwiesen:
Notiere die Formeln, Definitionen, Fachbegriffe oder Merksätze, die du dir beim Lernen schwer merken konntest, sofort auf der Rückseite deines Aufgabenblattes, wenn du es in den Händen hältst!
Würdest du alles auf ein leeres Blatt schreiben, könntest du des Spickens verdächtigt werden. Falls Unsicherheit oder Konzentrationsschwäche auftreten, schau auf deine Notizen und in 90% der Fälle helfen sie dir weiter.
Manchmal hat man auch in der mündlichen Prüfung die Gelegenheit, etwas zu notieren. Nutze sie! Sowohl für die schriftliche als auch die mündliche Prüfung gilt folgender Tipp:
Arbeite beim Lernen mit Akronymen und Eselsbrücken!
Eselsbrücken kennt jeder, doch was verbirgt sich hinter einem Akronym? Ein Beispiel für ein Akronym ist WUMS. Es steht für die Rechte eines Käufers bei mangelhafter Warenlieferung: Wandlung, Umtausch, Minderung, Schadensersatz. Aus den Anfangsbuchstaben der zu lernenden Begriffe wird also ein Wort gebildet. Zum Lernen von Begriffen, die keine feste Reihenfolge haben, eignet sich diese Technik besonders. Akronyme haben zwei Vorteile.
Zum einen entspricht die Anzahl der Buchstaben der Anzahl der zu lernenden Begriffe. Dadurch wird verhindert, dass man einen Begriff komplett vergisst. Zum anderen helfen dir die Anfangsbuchstaben dabei, dich an die Begriffe zu erinnern. Wenn du über ein gutes Kurzzeitgedächtnis verfügst, sieh dir unmittelbar vor Prüfungsbeginn noch einmal deine Akronyme an.
Notiere die Akronyme sofort auf deinem Aufgabenblatt!
Auf diese Weise kannst du mit wenigen Wörtern schon sehr viel Wissen sicher ablegen und darauf bei Bedarf zurückkommen. In 99% der Fälle helfen die Akronyme, einen Blackout zu vermeiden. Manch ein Lerner merkt sich übrigens sogar Buchstabenfolgen, die kein Wort ergeben.
Achte beim Lernen darauf, den Stoff auch zu verstehen und nicht nur auswendig zu lernen!
Formuliere Fragen zu dem Thema und betrachte den Stoff aus verschiedenen Blickwinkeln! Verknüpfe das neue mit deinem bereits vorhandenen Wissen! Arbeite vielleicht mit KommilitonInnen zusammen. Erklärt man anderen den Stoff, versteht man ihn selbst auch besser. Im Artikel Alternativen zum Auswendiglernen findest du Ideen, wie du effektiv neues Wissen aufnehmen kannst.
Eine 100%ige Absicherung gegen Blackouts gibt es nicht. Wer befürchtet, bei einem Blackout in Panik zu geraten, der sollte sich zusätzlich auch mental auf die Situation eines Blackouts einstellen.
Bereite dich mental auf einen Blackout vor!
Im Sport ist Mentaltraining weit verbreitet. Leistungssportler stellen sich ihren Wettkampf genau vor. Mach es wie sie: Stell dir vor, wie du den Prüfungsraum betrittst, die Prüfer begrüßt bzw. Dein Aufgabenblatt bekommst. Visualisiere alles so deutlich wie nur möglich. Du siehst bzw. hörst die Fragen und deine Antworten.
Nimm dir dafür Zeit und gehe jeden Teil der Prüfung langsam im Geiste durch. Sieh dich auch, wie du einen Blackout hast. Wie du dabei ruhig bleibst und dich konzentrierst. Nach kurzer Zeit springt Dein Denken wieder an und du fährst fort, als wäre nichts gewesen.
Mehr Infos zum Thema Mentaltraining gibt es z.B. hier.
Lass dich vorher nicht verrückt machen!
Ein weit verbreitetes Phänomen sind Schilderungen über gemeine Prüfer und unverständliche oder zu schwere Aufgabenstellungen. Gestreut werden diese Gerüchte meistens von Prüflingen, die selbst durchgefallen sind oder ein schlechtes Resultat erzielt haben. Sie meinen es nicht böse, wenn sie ihre Erfahrungen weitergeben und dabei dramatisieren bzw. die Schuld in erster Linie bei den Prüfern und den Aufgaben suchen.
Es handelt sich dabei um ein psychologisches Phänomen, das dem Schutz der Persönlichkeit und des eigenen Selbstwertgefühls dient. Höre diese Schauergeschichten nicht an oder frage genau nach, was und wie gefragt wurde und woran das schlechte Abschneiden gelegen hat. Du musst allerdings davon ausgehen, dass die Wahrnehmung des Prüflings verzerrt ist. Versuche lieber, erfolgreiche Prüflinge zu treffen, die dir hilfreiche Tipps zum Prüfungsablauf oder zur Art der Fragen geben können.
3. Was nicht unbedingt hilft
In den meisten Ratgebern und Artikeln zum Thema Blackout stehen Entspannungsmethoden wie die Progressive Muskelentspannung oder Bauchatmung ganz oben auf der Ratschlagliste.

Keine Panik! Blackouts lassen sich mit ein paar Helferchen wieder abschütteln
Der Sinn dieser Empfehlungen ist aus zwei Gründen fraglich: Eine Schwierigkeit ist, dass diese Techniken sehr gut beherrscht werden müssen, um in einer Stresssituation angewandt werden zu können.
Das größere Problem besteht darin, dass die natürliche Reaktion auf einen Blackout Flucht oder Angriff ist. Der Blackout dient nämlich unserem Schutz. In einer Gefahrensituation wird die Informationsübertragung zwischen den Nervenzellen des Gehirns blockiert. Dadurch können wir uns ganz auf Flucht oder Angriff konzentrieren - leider auf nichts anderes.
Verantwortlich dafür sind die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin. Sie bewirken, dass das Denken ausgeschaltet, der Blutdruck erhöht, Fett- und Zuckerreserven mobilisiert werden. (vgl. Vester, 2009, S. 37 und 101ff.). Bei wem diese Prozesse im Körper ablaufen, der kann sich von Natur aus schlecht auf Entspannungsverfahren einlassen, auch wenn diese vielleicht wirksam wären.
Wer nicht zu den Entspannungsprofis zählt, der sollte zunächst lieber Dampf ablassen oder sich ablenken.
4. Wirksame erste Hilfe bei Blackout

Sabine Grotehusmann (Köln) arbeitet als Autorin, Studienrätin und Trainerin mit den Schwerpunkten: Lernen und Kreativität.
www.derpruefungserfolg.de
1. Lass Dampf ab!
Baue die mobilisierte Energie ab und lebe die Flucht bzw. den Angriff im Kleinen aus:
Verlasse den Raum und bewege dich!
Steh kurz auf und öffne das Fenster!
Schüttle Hände und Füße aus, reiß Mund und Augen weit auf, fluche laut (außerhalb des Prüfungsraumes)!
Zerreiße ein Blatt oder knülle es zusammen! (Nimm Dir dafür möglichst ein extra "Wutblatt" mit.)
Atme durch die Nase ein und kräftig durch den Mund aus. Bilde dabei einen Laut wie ein F. Schüttle bei der Ausatmung eine Hand aus. Führe dazu einen Arm schnell und kräftig von oben nach unten. Halte oben die Finger Deiner Hand zusammen und löse unten die Anspannung!
Wenn du unauffällig Deine Energie abbauen möchtest, dann:
Fluche schriftlich auf Schmierpapier!
Bewege kräftig Deine Zehen und Füße unter dem Tisch!
Spanne Arm-, Bein- und / oder Bauchmuskeln an, halte im Sitzen den Großteil Deines Gewichts mit den Beinen!
Rolle mit den Augen langsam von ganz links nach ganz rechts und wieder zurück. Du kannst die Augen dabei offen oder geschlossen halten. Wiederhole die Bewegung 20-mal. Diese Methode heißt Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) und wird in der Psychotherapie zur Traumabearbeitung aber auch bei verschiedenen Ängsten erfolgreich eingesetzt. Mehr dazu unter:
https://www.emdr.de
2. Beschäftige Dich und lenke Dich ab!
In der mündlichen Prüfung ist es bei einem Blackout notwendig, Denkzeit zu gewinnen.
Trink einen Schluck Wasser!
Bitte den Prüfer um die Wiederholung der Frage!
Sage, dass du etwas Zeit brauchst um über die Fragestellung nachzudenken!
Frage nach. "Habe ich Sie richtig verstanden...?"
Dieses Verhalten wird, wenn es natürlich auftritt, als Übersprunghandlung bezeichnet.
Iss etwas!
Schreibe eine Aufgabe ab!
Sortiere und nummeriere Deine Blätter!
Ziehe Ränder auf noch unbenutztem Klausurpapier!
Mach das Fenster auf!
Spitze Deine Bleistifte an!
Schreibe auf, was du am Abend zuvor gegessen hast!
Wenn du die Panik erfolgreich abgewehrt hast und der seltene Fall eintreten sollte, dass du dich immer noch nicht an das Gelernte erinnerst, hilf deinem Gehirn mit einer der nachfolgenden Methoden wieder auf die Sprünge. Das Denken springt leichter wieder an, wenn das Gehirn aktiv ist und Informationen im Kopf fließen.
3. Bring Dein Denken wieder in Fluss!
Alphabet-Technik
Nimm ein DINA4 Blatt und schreibe das Alphabet von oben nach unten auf. Notiere dann zu den einzelnen Buchstaben, was dir zu Deiner Aufgabe einfällt. Springe hin und her und schreibe dort etwas auf, wo dir gerade eine Idee gekommen ist. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Auch ist es nicht wichtig, das ganze Alphabet auszufüllen. Dafür kannst du gern auch mehrere Wörter mit demselben Anfangsbuchstaben notieren.
Die Buchstaben helfen Deinem Gehirn dabei, sich zu erinnern. Diese Methode wirkt außerdem durch ihren spielerischen Charakter beruhigend. Gleichzeitig sammelst du dabei wieder deine Konzentration und findest leicht in deine Prüfung zurück.
Die ABC-Liste ist auch für die Vorbereitung einer Prüfung nützlich. Ein Beispiel für eine ABC-Liste findest du in unserem Artikel Alternativen zum Auswendiglernen.
Unzensierte Ideensammlung
Sollte die Zeit knapp sein, kannst du direkt die Prüfungsfrage noch einmal durchlesen. Dann schreibe alles auf, was dir einfällt. Egal ob es dazu passt oder nicht. Es ist wichtig, das Denken nicht zu zensieren! Es werden mit Sicherheit einige gute Ideen dabei sein, die Du dann weiterentwickeln kannst.
BrainGym
Um das Denken im Fluss zu halten, haben sich Koordinationsübungen bewährt. Sie fördern den Austausch zwischen den Gehirnhälften.
Mit Klick auf den Button stimmst du folgendem zu: Dieses eingebettete Video wird von YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA bereitgestellt.
Beim Abspielen wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird YouTube mitgeteilt, welche Seiten du besuchst. Wenn du in deinem YouTube-Account eingeloggt bist, kann YouTube dein Surfverhalten dir persönlich zuzuordnen. Dies verhinderst du, indem du dich vorher aus deinem YouTube-Account ausloggst.
Wird ein YouTube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln.
Wer das Speichern von Cookies für das Google-Ads-Programm deaktiviert hat, wird auch beim Anschauen von YouTube-Videos mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. YouTube legt aber auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsinformationen ab. Möchtest du dies verhindern, so musst du das Speichern von Cookies im Browser blockieren.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei „YouTube“ findest du in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://youtu.be/F36HTk6xZeo
Alles Gute für die Prüfung!
5. Quellen und gleichzeitig Buchtipps (Werbung)
Die Bücher wurden redaktionell ausgewählt. Wird über einen der folgenden Affiliate-Links zu Amazon eingekauft, so erhalten wir eine Provision.
Wen die Sicht eines Psychotherapeuten zum Thema Prüfungsangst interessiert, sei die Seite des Therapeuten Dr. Dr. med. Herbert Mück empfohlen.
Anmerkung der Redaktion:
Das oben genannte Datum zeigt lediglich den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung an.