Studieren neben dem BerufBerufsbegleitend studieren

Studiengänge gesucht?
1. Was heißt berufsbegleitend studieren?
Es heißt, hauptsächlich berufstätig zu sein und parallel dazu ein Studium zu absolvieren. Dabei setzt die Berufstätigkeit voraus, dass der oder die Studierende schon einen Beruf hat.
Ist der erste Beruf das Ergebnis einer betrieblichen oder schulischen Berufsausbildung kommt ein berufsbegleitender Bachelorstudiengang als akademische Weiterbildungsmaßnahme in Betracht. Das gilt selbst für Berufstätige ohne Abitur, denn nach einem Beschluss der Kultusministerkonferenz im Jahr 2009 wurden die Regelungen zum Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte gelockert. Ist der erste Beruf das Ergebnis eines grundständigen Studiums, fällt die Wahl meist auf einen berufsbegleitenden Masterstudiengang.
Beruf ja, aber keinen Job? Wer zwar einen Beruf hat, aber (noch) nicht erwerbstätig ist, kann sich für ein weiterführendes duales Studium entscheiden. Hier wird das Studium mit der praktischen Ausbildung in einem Betrieb kombiniert, in dem man später auch arbeiten wird. Für Abiturienten gibt es das duale Studium als Erstausbildung.
Was ist das Besondere an berufsbegleitenden Studiengängen?
Berufsbegleitende Studiengänge sind in der Regel inhaltlich auf Berufstätige zugeschnitten und außerdem so konzipiert, dass sie sich mit einer Vollzeit- oder Teilzeit-Berufstätigkeit vereinbaren lassen:
Entweder es handelt sich um Fernstudiengänge, bei denen die Studierenden zeitlich und örtlich flexibel lernen können, oder
um Präsenzstudiengänge, bei denen die Unterrichtszeiten zeitlich geblockt sind und/oder sich auf die Abendstunden und Wochenenden konzentrieren.
Darüber hinaus gibt es Mischformen beider Konzepte.
Berufsbegleitende Studiengänge werden nicht nur in Teilzeit, sondern auch in Vollzeit angeboten. Im Idealfall können die Bewerber zwischen beiden Varianten wählen.
Für wen ist ein berufsbegleitendes Studium gedacht?
Bei der Konzeption berufsbegleitender Studiengänge haben die Hochschulen vornehmlich Berufstätige im Blick, die …
Führungsaufgaben übernehmen wollen,
sich neue Aufgabenfelder in ihrem Beruf erschließen wollen oder eine Spezialisierung anstreben,
sich in ihrem Beruf akademisch weiterbilden wollen,
in einem Berufsfeld arbeiten, das sich stark verändert und neue Kompetenzen erfordert oder
einen Arbeitsplatz innehaben, der sehr spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert, die üblicherweise in einem grundständigen Studium oder durch eine Berufsausbildung nicht vermittelt werden.
2. Struktur, Organisation und Dauer: Wann, wie und wo wird studiert?
Besonderheiten gegenüber dem üblichen Vollzeit-Präsenzstudium bestehen vor allem hinsichtlich der Studienzeiten und der Lehr- und Lernformen.
Bei Präsenzstudiengängen liegen die Lehrveranstaltungen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten, damit die Studierenden weiterhin erwerbstätig sein können. Bei einem Abendstudium geht es wochentags nach der Arbeit noch für drei oder vier Stunden an die Hochschule, manchmal auch am Wochenende ganztags. Andere Studienkonzepte blocken die Unterrichtszeiten. Dann konzentriert sich das Studium vor Ort auf einige Wochenenden oder einzelne Wochen im Jahr.
Bei einem Fernstudium gibt es zwar deutlich weniger Präsenzzeiten, das heißt aber nicht, dass der Zeitaufwand geringer ist. Hier können die Studierenden nur selbst entscheiden, wann und wo sie sich dem Studium widmen wollen.
Neben dem klassischen Präsenzstudium und den Studienbriefen beim Fernstudium gibt es computer- bzw. internetbasierte Lehranteile (E-Learning), eine Kombination herkömmlicher Lehr- und Lernmethoden mit E-Learning-Anteilen (sog. Blended Learning), Praxisphasen, Projektstudien und hier und da auch Ansätze eines sog. Work-based-Trainings, bei dem versucht wird, den Ort der beruflichen Tätigkeit und die dort anfallenden Aufgaben systematisch in das Studium einzubeziehen.
Auch wenn Studiengänge auf den Unterricht vor Ort weitestgehend verzichten, ist in aller Regel sichergestellt, dass die Studierenden über einen Online-Campus, Foren und/oder Chatrooms mühelos Kontakt zu Dozenten und Kommilitonen aufnehmen können.
Mehr Details zu den Formen des Fernunterrichts gibt es im Artikel zum Fernstudium.
Welche Studiendauer und welcher Zeitaufwand sind zu erwarten?
Bei Vollzeit-Bachelorstudiengängen beträgt die Studienzeit auf jeden Fall mehr als drei Jahre und bei Teilzeit-Bachelorstudiengängen voraussichtlich zwischen vier und fünf Jahre. Für Masterstudiengänge sind im Falle eines Vollzeitstudiums etwa ein bis zwei Jahre einzuplanen, bei einem Teilzeitstudium können es auch drei oder vier Jahre werden. Vollzeit bedeutet 40 Stunden pro Woche, Teilzeit in der Regel 15–20 Stunden pro Woche.
Alle Angaben sind aber nur grobe Richtwerte. Im konkreten Fall kann es auch ganz anders aussehen. Ist es beispielsweise möglich, sich eine einschlägige Vorbildung und/oder Berufstätigkeit anrechnen zu lassen, verkürzt sich die Studienzeit unter Umständen erheblich. Man absolviert in diesem Fall eine Eignungsprüfung und wird daraufhin in ein höheres Semester eingestuft.
Eine Rolle spielt auch, ob man Vorkenntnisse in Bezug auf wissenschaftliches Arbeiten und/oder auf die Studieninhalte mitbringt. Wer erst mal verstehen muss, wie Studieren funktioniert oder sich in ein neues Themengebiet einfinden will, braucht sicher mehr Zeit als jemand, der schon ein Studium abgeschlossen hat und/oder mit dem Fachgebiet des Studiums vertraut ist.
Schließlich gibt es Studiengänge, bei denen von vornherein feststeht, dass sich der Zeitaufwand in den einzelnen Semestern deutlich unterscheiden wird. Dass es darüber hinaus in jedem Studiengang stressige und weniger stressige Phasen gibt, ist klar.
3. Studium und Berufstätigkeit
Muss das Studium etwas mit meiner Berufstätigkeit zu tun haben? Die meisten berufsbegleitenden Studiengänge knüpfen in der Tat an die Arbeit in einem bestimmten Berufsfeld an oder richten sich an eine bestimmte Berufsgruppe. So wird vielerorts z. B. eine einschlägige Berufstätigkeit während des Studiums vorausgesetzt oder es ist vorgesehen, dass Praxisanteile des Studiums im eigenen Betrieb absolviert werden.
Trotzdem gibt es auch Studiengänge, die Quereinsteigern aus anderen Berufen oder Berufsfeldern offenstehen. Wer das Studium als „Umschulung“ nutzen will und letztlich einen ganz neuen Beruf anstrebt, sollte allerdings für sich realisieren, dass das Studium dann definitiv reines Privatvergnügen ist und vom Arbeitgeber keinerlei Zugeständnisse in zeitlicher Hinsicht zu erwarten sind.
Kann ich das Studium in meine Berufstätigkeit einbeziehen?
Das wäre sogar äußerst wünschenswert. Ob es sich aber auch realisieren lässt, ist von mehreren Faktoren abhängig: Zunächst müssen Konzept und Inhalte des gewählten Studiengangs mit den beruflichen Aufgaben kompatibel sein. Eine gewisse Flexibilität am Arbeitsplatz ist ebenfalls erforderlich.
Vor allem aber ist wichtig, dass der Arbeitgeber das Studium unterstützt, weil er an der Fortbildung seiner Mitarbeiter interessiert ist. Die Chancen, dass dem so ist, stehen nicht schlecht, denn der Fachkräftemangel ist vielerorts schon jetzt spürbar – und er wird eher zu- als abnehmen.
In einem nächsten Schritt ist dann zu klären, inwieweit das Studium in den Berufsalltag integriert werden kann. Ist der Arbeitgeber z. B. „nur“ bereit, die Arbeitszeiten studiengerecht zu gestalten und die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen und Prüfungen zu ermöglichen oder kann er sich auch vorstellen, die beruflichen Aufgaben auf das Studium zuzuschneiden und ein Anwendungsfeld für die Durchführung praktischer Studienprojekte zu schaffen?
Manche Studiengänge setzen voraus, dass der Arbeitgeber in diesem oder jenem Punkt schriftlich seine Zustimmung erklärt oder einen Kooperationsvertrag mit der Hochschule eingeht, in dem er sich verpflichtet, das Studium in dieser oder jener Weise zu unterstützen. In diesen Fällen wird vielfach jedoch nicht mehr von einem berufsbegleitenden, sondern von einem berufsintegrierten Studium gesprochen, das im Ergebnis den Charakter eines dualen Studiums hat.
Welche Rechtsansprüche können helfen, Beruf und Studium zu vereinbaren?
a) Anspruch auf Teilzeitarbeit
In der Theorie gibt es zwar auch das Vollzeitstudium neben der vollen Berufstätigkeit, in der Praxis wird es jedoch kaum zu realisieren sein. Schlafen und essen muss man schließlich auch irgendwann – von der nötigen Zeit für Erholung, Familie und Freunde ganz zu schweigen. Es heißt also, entweder beim Studium oder beim Beruf zeitliche Abstriche zu machen. Beim Studium ist es die Entscheidung für ein Teilzeitstudium, beim Beruf die Teilzeitarbeit. Hier ist wichtig zu wissen, dass Arbeitnehmer, die bislang Vollzeit beschäftigt waren, unter folgenden Voraussetzungen einen Anspruch auf Teilzeitarbeit haben:
Sie arbeiten seit mindestens sechs Monaten bei ihrem Arbeitgeber und
der Arbeitgeber beschäftigt regelmäßig mehr als 15 Arbeitnehmer (inkl. Teilzeitkräfte/Minijobber, aber ohne Auszubildende).
Geregelt ist das in § 8 TzBfG. Sind die Voraussetzungen erfüllt, kann man einen Antrag auf Arbeitszeitverkürzung stellen, der mindestens drei Monate vor dem Beginn der Teilzeitarbeit dem Arbeitgeber vorliegen muss. Ablehnen kann der Arbeitgeber den Antrag nur aus betrieblichen Gründen.
Wichtig: Wer sich einmal für Teilzeitarbeit entschieden hat, kann seine Arbeitszeit zu einem späteren Zeitpunkt nicht ohne Weiteres wieder aufstocken!
b) Anspruch auf Bildungsurlaub
In den meisten Bundesländern haben Arbeitnehmer einen Anspruch auf (bezahlten) Bildungsurlaub bzw. Bildungsfreistellung. Ausgenommen sind Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen. Meist kann man sich für fünf Tage im Jahr oder zehn Tage innerhalb von zwei Jahren von der Arbeit freistellen lassen, um beispielsweise an Veranstaltungen zur beruflichen Weiterbildung teilzunehmen.
Voraussetzung ist stets, dass die Bildungsveranstaltung als solche anerkannt ist (ob das der Fall ist, wissen die Anbieter, es lässt sich aber häufig auch über spezielle Datenbanken im Internet recherchieren). Achtung: Der Arbeitgeber darf den Antrag auf Bildungsurlaub aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen. Näheres ist den Regelungen der einzelnen Länder zu entnehmen.
4. Angebot an berufsbegleitenden Studiengängen
Studiengänge für Berufstätige gibt es mittlerweile an vielen öffentlichen und privaten Universitäten und (Fach-)Hochschulen. Teilweise kooperieren die Anbieter mit Unternehmen oder anderen externen Partnern.
Die meisten Studiengänge werden in den Wirtschaftswissenschaften angeboten. Als weitere Fachrichtungen sind vertreten: die Ingenieur- und Naturwissenschaften, die Pflege- und Gesundheitswissenschaften, Mathematik und Informatik sowie das Sozialwesen. Es lohnt sich aber durchaus, auch nach anderen Studiengängen Ausschau zu halten. Das Studienangebot wird ständig ausgebaut. Im Moment gibt es deutlich mehr Masterstudiengänge für Berufstätige als Bachelorstudiengänge.
In der Studis Online-Datenbank wird nach Fernstudium und berufsbegleitendem Studium unterschieden. Denn ein Fernstudium ist im Grunde immer auch berufsbegleitend möglich, ein berufsbegleitendes Studium muss aber keineswegs ein Fernstudium sein. D.h. wir fassen unter berufsbegleitend nur die Studiengänge, die einen höheren Präsenzanteil haben (oder vollständig Präsenzstudiengänge sind), der aber organisatorisch so gelegt ist (Abendstudium, Wochenende, Blockunterricht), dass in der Regel eine Berufstätigkeit möglich bleibt. Wem dies egal ist, der sollte in unser Datenbank sowohl nach Fernstudiengängen als auch nach berufsbegleitenden Studiengängen suchen.
Welche Abschlüsse sind möglich und anerkannt?
Abgeschlossen werden alle Studiengänge entweder mit einem Bachelor- oder Mastergrad. Die Abschlüsse sind genau dieselben wie bei regulären Vollzeit-Präsenzstudiengängen. Es gibt keine Unterschiede in der Wertigkeit. Der Master berechtigt zur Promotion.
Wer keinen kompletten Studiengang absolvieren möchte, trotzdem aber nicht auf akademische Bildung verzichten will, kann vielerorts auch ein Hochschulzertifikat erwerben. In diesem Fall beschränkt sich das Studium auf einen kleinen Ausschnitt eines Studiengangs.

Arbeit und (Weiter-)Bildung „nebenbei“ lassen sich in Form eines berufsbegleitenden Studiums realisieren.
5.Voraussetzungen zum Studium
a) Zugangsvoraussetzungen beim Bachelorstudium
Die Zugangsvoraussetzungen für ein Bachelorstudium wurden in den letzten Jahren in allen Bundesländern gelockert. Wer weder Abitur noch Fachhochschulreife besitzt, ist damit nicht mehr per se vom Studium ausgeschlossen. Die meisten Möglichkeiten haben Berufstätige mit Meisterprüfung oder abgeschlossener Aufstiegsfortbildung: Sie können in fast allen Ländern alle Fächer studieren, die auch Abiturienten offenstehen. Ansonsten besteht zumindest die Chance auf einen fachgebundenen Hochschulzugang.
Das heißt: Bewerber mit Berufsausbildung, die bereits einige Jahre in ihrem Beruf gearbeitet haben, können sich für einen Studiengang bewerben, der fachlich mit ihrem bisherigen Beruf zu tun hat. Im Detail weichen die Regelungen in den Ländern erheblich voneinander ab.
b) Zugangsvoraussetzungen beim Masterstudium
Masterstudiengänge setzen – von seltenen Ausnahmen abgesehen – einen ersten Hochschulabschluss voraus. Bei weiterbildenden Masterstudiengängen, zu denen berufsbegleitende Studiengänge in der Regel gehören, ist außerdem mindestens ein Jahr Berufserfahrung erforderlich. Unter Umständen sind darüber hinaus eine einschlägige berufliche Tätigkeit neben dem Studium und Englischkenntnisse nachzuweisen.
c) Persönliche Voraussetzungen
Sie stehen in keiner Zulassungsordnung, sind aber trotzdem unverzichtbar, um das Studium zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Die Doppelbelastung durch Beruf und Studium über einen langen Zeitraum ist nämlich nicht zu unterschätzen. Es heißt auf jeden Fall, in vielen anderen Bereichen Abstriche machen zu müssen. Das soziale Leben wird voraussichtlich ebenso leiden wie der Freizeitausgleich. Das kann schon für sich genommen richtig schlechte Laune machen. Darüber hinaus sind Konflikte in der Beziehung oder Familie nicht ganz unwahrscheinlich. Man muss sich also sehr genau überlegen, wie belastbar man selbst ist und wie das Studium mit der Lebenssituation vereinbar ist.
Ein anderer wichtiger Punkt ist das Thema Selbstmotivation und Disziplin. Davon benötigt man auf jeden Fall eine große Portion, um sich nach einem achtstündigen Arbeitstag oder trotz einer arbeitsreichen Woche am Wochenende [url=https://www.studis-online.de/Studieren/Lernen/selbstmotivation.php]noch auf die Hochschulbank zu setzen
.
Noch schwerer kann es fallen, die Disziplin für ein Fernstudium aufzubringen. Hier ist man zwar zeitlich flexibel, muss aber selbst die Kurve kriegen, sich auch ohne feste Termine tatsächlich hinzusetzen und was zu tun – abends und am Wochenende, wenn andere sich vergnügen. Außerdem fehlt der soziale Kontakt zu Gleichgesinnten, die man im Präsenzstudium treffen kann. Ein Vorteil natürlich: Es geht nicht auch noch Zeit für die Anfahrt zur Hochschule verloren.
6. Alles zu Kosten & Finanzierung
Das Kostenspektrum bei berufsbegleitenden Studiengängen ist so groß, dass sich die Frage nur schwer mit konkreten Beträgen beantworten lässt. Zudem sind die Kosten von verschiedenen Faktoren abhängig: Muss der Studiengang über Studiengebühren finanziert werden oder gibt es öffentliche Gelder? Darf eine öffentliche Hochschule im konkreten Fall Studiengebühren erheben oder nicht? Was muss eigentlich genau finanziert werden? usw.
Wichtig: Die Kosten sagen für sich genommen nichts über die Qualität eines Studienganges aus.
Wissen sollte man, dass zumindest berufsbegleitende Masterstudiengänge in der Regel in den Bereich der Weiterbildung fallen, in dem auch öffentliche Hochschulen, die sonst ein kostenfreies Studium anbieten, vielerorts Studiengebühren verlangen dürfen. Auch die FernUni Hagen als einzige öffentliche Fernuniversität in Deutschland schreibt auf ihrer Website, dass ihre weiterbildenden Studiengänge nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert werden und daher kostendeckende Gebühren von den Studierenden erhoben werden.
Nachfolgend ein paar beliebig ausgewählte Kostenbeispiele (Stand Oktober 2023, ohne Gewähr!), die weder den Anspruch erheben, repräsentativ zu sein, noch irgendeiner Systematik folgen. Aufgeführt sind die Kosten speziell für das berufsbegleitende Studium.
Vorher aber noch eine gute Nachricht: Wer schon eine Berufsausbildung hat, kann die Kosten des Studiums als Werbungskosten von der Steuer absetzen, und zwar in voller Höhe! Mehr dazu im Artikel Ausbildungskosten absetzen.
| Hochschule | Studiengang | ECTS-Credits | Gesamtkosten* |
| FOM Hochschule (privat) | Banking & Finance (Bachelor) | 180 | 14.490 € |
| Verbund verschiedener Fachhochschulen (öffentlich) | Soziale Arbeit (Bachelor) (basa-online.de) | 180 | 1.105 |
| Universität Kassel (öffentlich) | Industrielles Produktionsmanagement (Master) | 120 | 17.700 € |
| Uni Wuppertal (öffentlich) | Arbeits- und Organisationspsychologie (Master) | 120 | 10.600 € plus Pauschalen für Präsenzseminare (~1.200 €) |
| AKAD (privat) | Angewandtes Management (Master) | 120 | ab ca. 13.000 € |
*Üblicherweise sind die Kosten ratenweise zu begleichen. Etwaige Semestergebühren an staatlichen Hochschulen werden nicht berücksichtigt. Alle Angaben Stand Oktober 2023, aber ohne Gewähr!
Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?
Da Berufstätige bereits einen Beruf haben und ihren Lebensunterhalt über ihre Arbeit finanzieren können, kommen die üblichen Geldquellen, mit denen junge Menschen normalerweise ihr Studium finanzieren, für ein berufsbegleitendes Studium meist nicht Betracht. Trotzdem müssen die Kosten des Studiums natürlich irgendwie gestemmt werden. Mit etwas Glück, guten Leistungen und Engagement besteht die Chance auf ein Stipendium, vielleicht auch auf finanzielle Unterstützung durch den Arbeitgeber. Ansonsten bleibt nur die Aufnahme eines Kredits.
Wer eine Berufsausbildung abgeschlossen und mindestens zwei Jahre in seinem Beruf gearbeitet hat, kann bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten z. B. das Aufstiegsstipendium der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung (SBB) ins Visier nehmen. Mit dem Stipendium soll Berufserfahrenen ohne Studium gezielt die akademische Weiterbildung ermöglicht werden. Für Berufseinsteiger gibt es das Weiterbildungsstipendium. Die Stipendien werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert.
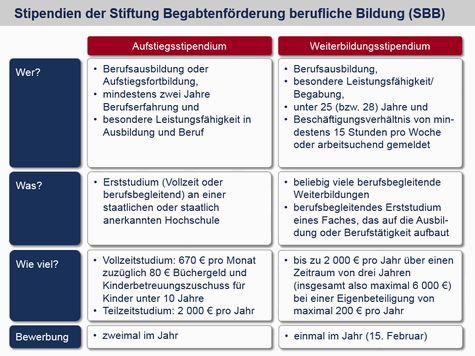
Stipendien der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung (SBB)
Ansonsten empfiehlt es sich, genauer nachzuforschen, ob und inwiefern die Hochschule selbst Hinweise zur Finanzierung gibt (auf der Website schauen oder einfach mal dort nachfragen).
Bei einzelnen Studiengängen kann es immer sein, dass irgendwer einen Geldtopf spendiert, um gerade die Studierenden dieses Studiengangs zu fördern.
An vielen öffentlichen Hochschulen kann man sich außerdem für das Deutschlandstipendium bewerben.
Falls der Arbeitgeber die Weiterbildungspläne unterstützt, kann man auch versuchen, in einem persönlichen Gespräch auszuloten, ob er zu einer finanziellen Förderung bereit ist. Das funktioniert natürlich umso besser, je vorteilhafter der Zuwachs an Bildung für sein Unternehmen ist.
Mit etwas Glück lässt er sich auf die Gewährung eines Kredits ein, ermöglicht bezahlten Sonderurlaub, überweist monatlich oder jährlich einen pauschalen Betrag fürs Studium oder finanziert sogar die gesamte Ausbildung. Klar ist, dass jede finanzielle Unterstützung des Arbeitgebers mit einer Gegenleistung verbunden sein wird, die nicht nur darin besteht, dass man das Studium auch zu Ende bringt.
Wahrscheinlich muss man sich darüber hinaus verpflichten, zumindest für einen gewissen Zeitraum anschließend im Unternehmen zu bleiben. Der Arbeitgeber will verständlicherweise selbst von den Früchten des Studiums profitieren, das er (mit-)finanziert hat.
Klappt es weder mit einem Stipendium noch mit der Unterstützung des Arbeitgebers bleibt nur die Möglichkeit, einen (Studien-)Kredit aufzunehmen. Einige Studienkredite sind allerdings nur bei „normalem“ Studium zugänglich, Ausnahmen stellen der KfW-Studienkredit sowie der Bildungsfonds von Deutsche Bildung dar. (Weitere Angebote mag es vereinzelt geben, allgemein gilt hier: Die Bedingungen bezüglich Zinsen, Rückzahlung und anderes genau durchsehen!)
Private Hochschulen machen häufiger selbst Vorschläge zur Finanzierung des Studiums über einen speziellen Kredit. Kredite für ein Studium (die nicht von vornherein als Studienkredit angeboten werden) sind ansonsten eher schwer zu erhalten – oder sehr teuer (hohe Zinsen, sonstige ungünstige Bedingungen). Je nach persönlicher Lage ist aber evtl. dennoch etwas möglich, Fragen kostet erstmal nichts. In jedem Fall sollte man etwaige Angebote genau und in Ruhe studieren, bevor man sich entscheidet, sie anzunehmen.
Zum Weiterlesen und Recherchieren:
- Alle berufsbegleitenden (Präsenz-)Studiengänge in Deutschland
- Alle Fernstudiengänge in Deutschland
- Studienführer Duales Studium
- Alle Dualen Studiengänge in Deutschland
- Teilzeitstudium – auch neben dem Beruf möglich
Dieser Artikel wurde ursprünglich von Nicola Pridik geschrieben. Im Laufe der Jahre wurde er immer wieder durch die Studis Online-Redaktion überarbeitet, entspricht also nicht mehr dem ursprünglichen Original der Autorin. Die letzte Veränderung wurde am oben angegebenem Datum vorgenommen.